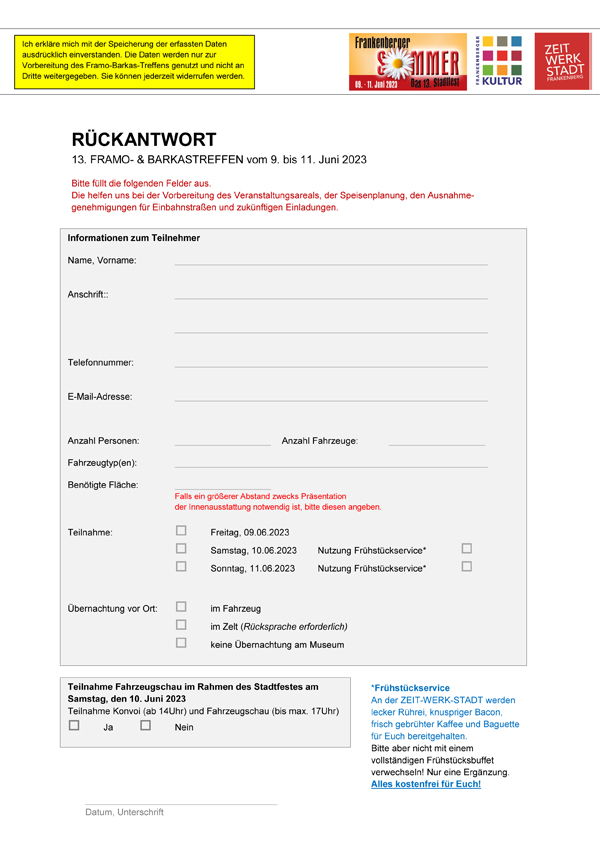1979 ERFUNDEN: DIESER WARTBURG FÄHRT MIT WASSER- UND SAUERSTOFF
Von Robert Preuße
Chemnitz – Ein Auto, das mit schadstofffreiem Antrieb läuft – daran wurde schon in der DDR geforscht. Der Ingenieur Hans-Joachim Glaubrecht (1929 bis 2020) entwickelte 1979 ein Verfahren, bei dem Wasserstoffperoxid als Antrieb für einen Wartburg genutzt wurde. Ein Modell kann heute noch im Museum für Sächsische Fahrzeuge Chemnitz begutachtet werden.

Schon zu DDR-Zeiten forschten Ingenieure an wasserstoffbetriebenen Autos. Ein Zeugnis dieser Zeit bildet der Wartburg in Dirk Schmerschneiders (52) Museum für Sächsische Fahrzeuge. © Uwe Meinhold
Das Prinzip des mit Wasserstoffperoxid (H202) betriebenen Wartburg ist relativ einfach: Das Wasserstoffperoxid wird mittels eines Katalysators verdampft.
Der dadurch entstehende Wasserdampf setzt eine Turbine in Gang. Die dadurch entstehende Kraft geht an ein Reduziergetriebe. An die Umwelt wird dabei ein Gemisch aus Wasserdampf und Sauerstoff abgegeben.
„Der Antrieb hat funktioniert. Aber man hat auch gleich gemerkt, dass es in dieser Form nicht klappen wird. Aus verschiedensten Gründen: Zum Beispiel ist der Verbrauch viel zu hoch“, erklärt Dirk Schmerschneider (52), Leiter des Museums für Sächsische Fahrzeuge Chemnitz.
Jedoch war Glaubrecht mit seiner Konstruktion eines umweltfreundlichen Antriebs „um ein paar Jahrzehnte voraus“.

Der Motor des Versuchsfahrzeugs „Wartburg W353“ wurde mit einer Wasserstoffperoxid-Turbine betrieben. © Uwe Meinhold

Zu hoher Verbrauch! Der Versuch war nicht von Erfolg gekrönt. © Uwe Meinhold

Das Museum für Sächsische Fahrzeuge in der Zwickauer Straße beheimatet allerhand Kuriositäten. © Uwe Meinhold
Alle Unterlagen und Testautos wurden vernichtet
Kurz vor der Wende wurde das Experiment eliminiert, alle Unterlagen vernichtet. © Repro: Uwe Meinhold
Kurz vor der Wende wurden die Versuche staatlicherseits aus nicht genannten Gründen abgebrochen und alle Unterlagen, sowie die Testautos vernichtet.
Nur durch Zufall ist der Wartburg (Glaubrechts Privatwagen) erhalten geblieben, da Glaubrecht den Turbinenantrieb heimlich darin installierte.
Hans-Joachim Glaubrecht schenkte dem Fahrzeugmuseum Chemnitz seinen Turbinen-Wagen. Auf die Frage, ob der umweltfreundliche Wartburg als Modell für die Zukunft taugt, antwortet Dirk Schmerschneider: „Das Spannende ist: Es gibt Technologien, die da waren, aus den verschiedensten Gründen in Vergessenheit gerieten und jetzt wieder Anwendung finden könnten.“

Weitere Infos gibt’s unter www.fahrzeugmuseum-chemnitz.de.
Titelfoto: Uwe Meinhold













:format(webp)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/madsack/WAZGJPKUIJEZVOKSQXBE6EXHRA.jpg)
:format(webp)/s3.amazonaws.com/arc-authors/madsack/7c2e793e-3630-49e1-aca1-236ae9ee7430.png)